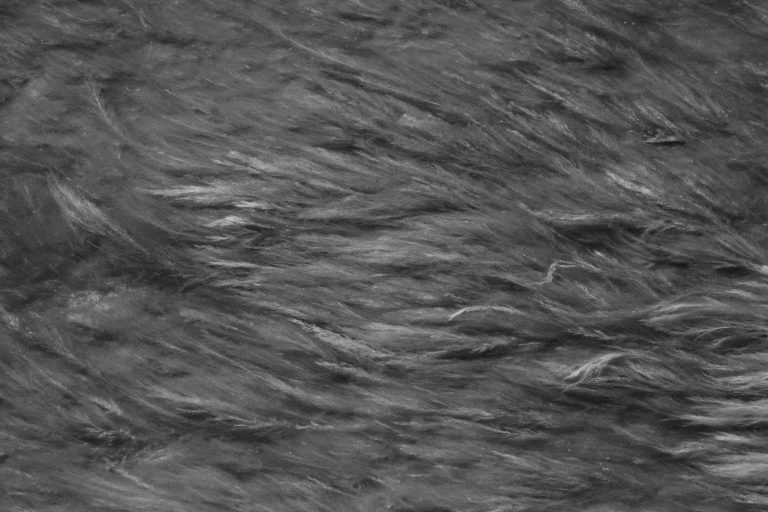Natürlich hatte ich Muffensausen. Kein Wunder, da war ja auch nichts weiter als ein erbärmliches kleines Loch im Berg. Es verströmte einen warmen Altmännermief, lugte scheu zwischen ein paar Hütten hervor und unter einem groben Holzbalken buckelte es wie ein Morbus-Scheuermann-Patient.
Der Reihe nach mussten wir einen Wisch unterschreiben. Von wegen Betreten auf eigene Gefahr. Ja danke, dachte ich, wirklich eine großartige Idee. Außer Malte, Leonie und mir war noch ein Dutzend anderer Touristen dabei. Wir fühlten uns alle unglaublich abenteuerlich in der Untertagekluft.
Aber durch unsere Kamerataschen und die fehlende Coca-Kugel in den Backentaschen waren wir leicht von den Minenarbeitern zu unterscheiden.
Unterhalb des Mineneingangs lagen die kargen kraterüberzogenen Hänge des Cerro Rico. Zur Stadt hin liefen sie sanft aus, waren in steter, wimmelnder Bewegung, die von den roten Helmen der mineros ausging. Nach einer halben Stunde tauchte endlich unser guía auf.
Hektisch redete er los, riss die Augen auf wie ein Wahnsinniger.
„Escúcheme, señor turista! Listen, please!”, rief er und fuchtelte umher, „I’m your guide today, you call me Bolívar, alright?“
Er rollte mit den Augen, begann eine Ansprache zur Geschichte der Mine und so weiter – eine Leier, dachte ich, die er täglich drei-, viermal abspulte.
„Okay, gringito, now please have a look over there, donde se ve la sangre de miles de llamas en la pared.“
Bolívar zeigte auf ein kleines Steingebäude seitlich des Mineneingangs. Vom Blut der Tiere war es schwarz bis unter den Giebel.
„Los mineros kill many lamas there“, sagte er, „for good luck!“, und wir Touristen raunten auf und dann der übliche Spiegelreflex – aber wir waren nicht schnell genug, um Fotos zu schießen, Bolívar wollte weiter. „Okay, vámonos, señor turista“, rief er, „go, go, go!” Eilig stiefelte er los und wir ihm nach.
Hinter der Schneekuppe des Illimani sah ich für einen Moment noch die Sonne flackern. Dann wurde es dunkel. Malte und Leonie gingen vor mir. Ihre gelben Gummistiefel leuchteten im Licht meiner Stirnlampe. Hinter mir hörte ich das Gegacker der andern Touris, dann, mit den Minuten, wurden auch sie stiller, verfielen schließlich in angestrengtes Schnaufen. Bereits nach wenigen Metern verzweigte sich der Stollen. Wir nahmen den mittleren Schacht, stolperten über Schienen am Boden, zogen die Köpfe ein.
Ich begann zu schwitzen. Je weiter wir in den Berg vordrangen, umso heißer und dünner wurde die Luft. Bolívars Gangart war immer schneller geworden, aber plötzlich rumpelte etwas gewaltig und da ging ein Ruck durch die Leute vor mir, „Ya vienen!“, hörte ich Bolívar rufen. „Step aside, gringo – step aside!“
Wir pressten uns in kleine Ausbuchtungen in der Wand. Dann kamen sie heran. Ich sah drei angestrengte, verschmierte Gesichter durch die hüpfenden Lichtkegel ziehen, vielleicht vierzehn-, fünfzehnjährige Burschen. Rennend zogen und schoben sie eine mit Gesteinsbrocken gefüllte Lore zwischen uns hindurch. Dort hinein warfen wir alle etwas von unseren Mitbringseln, wie Bolívar es uns eingeschärft hatte: Beutel mit Coca-Blättern, Zigaretten, refrescos, ceibo.
Diese Jungs, erklärte Bolívar, holten das abgebaute Material vom Ende des Stollens. Eine Strecke betrug etwa drei Kilometer und das bei achtzig Metern Höhenunterschied. Pro Schicht zwanzig, dreißig solcher Touren. Auf keinen Fall dürften wir denen in den Weg kommen.
Wir gingen weiter, bogen in einen Schacht ohne Schienen ab, kletterten über Geröll tiefer hinunter. Nach einer langen Passage, die wir auf den Knien krabbeln mussten, kamen wir schließlich zum Tío. Unglaublich hässlich saß er da, erwartete uns mit seinem riesigen, erigierten Schwanz. Sein weit aufgerissenes Maul war schwarz ausgemalt, die Hände hielt er auffordernd von sich gestreckt, die Schenkel staken aus denselben gelben Stiefeln wie unsere. Der gehörnte Kopf des Viehs und sein Schoß waren über und über mit Coca, Kippenstummeln und Lametta bedeckt.
Zu seiner Linken und Rechten ließen wir uns auf den abgesessenen in den Stein gehauenen Bänken nieder. Bolívar erzählte, der Tío sei eine Art Teufel oder Unterweltgott. Die Minenarbeiter besuchten ihn vor jeder Schicht, um seinen Zorn zu besänftigen und sich Glück unter Tage zu erbeten. Es gebe mehrere Dutzend Tío-Figuren im Berg, sagte Bolívar und zündete sich eine Zigarette an. Ich schielte zu Malte rüber, mit einem schrägen Grinsen saß er da, wippte mit dem Knie. Leonie, mir gegenüber, lauschte versonnen. Bolívar zog ein letztes Mal an seiner Kippe und schob sie dann qualmend ins Maul des Tío.
„El Tío nos mata, el Tío nos salva“, murmelte er. Dann bewarf er die Figur mit einer Handvoll Coca-Blätter, nahm einen Schluck aus einer Bierdose und kippte den Rest über den dicken roten Schwanz. Ernst blickte er in die Runde.
„Be obedient, my friend. And he save you.“
Er sei immer gut mit dem Tío ausgekommen, sagte Bolívar, sonst wäre er jetzt nicht mehr da. Mit dreizehn sei er in die Mine gekommen. Vor zwanzig Jahren habe er als einer der Ersten mit den Führungen begonnen. Mit dem Geld schicke er seine Töchter auf die Universität.
„Well, gracias a Usted, señor turista! Thank you!“, sagte er, haute sich auf die Schenkel und stand auf.
„Let’s go.“
Einer nach dem andern kletterten wir kurz darauf eine lange Leiter hinunter.
„Welcome to ‚El Infiernillo‘, mister“, verkündete Bolívar und flüsterte: „Duerme el demonio – be quiet, so he won’t wake up, alright?“
Manche lachten nervös. Malte stand neben mir. „Alter, so geil, so crazy“, hörte ich ihn leise sagen. Ich verfiel in Gedanken. Es beeindruckte mich, dass Bolívar sich bei uns bedankte. Und mein Gewissen wurde dadurch leichter. Auch die Arbeiter, denen wir jetzt immer wieder begegneten, die das Gestein in mächtigen Lederkörben auf dem Rücken trugen, die in Ecken gekauert Dynamitstangen zusammenbastelten, die pausenlos Schutt in Fässer schaufelten, die in metertiefen Spalten unter uns nach frischen Adern suchten, oft kaum älter als dreizehn Jahre – keiner von ihnen schien von unserer Anwesenheit genervt zu sein. Sie grüßten, bekamen etwas von unseren ‚Geschenken‘, dankten mit gerecktem Daumen und cocaschwarzem Grinsen.
Ich fühlte mich hilflos. Ein dicker Kloß im Hals. Auch die andern waren alle verstummt. Nur Bolívar redete unermüdlich, erklärte an allen Stationen, welche Arbeit jeweils verrichtet wurde.
Es war bizarr. Ich war nie an einem so hoch gelegenen Ort auf der Welt gewesen und gleichzeitig so tief unter der Erde. Nachdenklich – oder wegen des Sauerstoffmangels weggetreten – fiel ich hinter die Gruppe zurück. Sie kletterten eine Leiter hinauf. Als ich nach der ersten Sprosse griff, wurde mir schwarz vor Augen. Ich muss etwas trinken, dachte ich, holte die Wasserflasche aus dem Rucksack, trank. Verschnaufen, dachte ich, nur kurz etwas verschnaufen. Schweiß brach mir aus.
Ich kann mich doch einfach einen Moment hinlegen, fand ich, das wäre schon okay. Es war verlockend. Nein, los jetzt, sagte ich mir und griff nach einerLeitersprosse. Ein Stück verbliebener Rationalität in mir hatte noch einmal gewonnen. Ich blickte hinauf. Da war niemand. Ich schaltete kurz die Lampe aus, um herauszufinden, ob oben noch Licht von den andern zu sehen war.
Natürlich war es genau in diesem verblödet symbolischen Moment des ausbleibenden Lichts, dass meine letzte Kraft, meine Beherrschung oder irgendwas in mir wegsackte und ins Bodenlose sauste wie ein gekappter Aufzug. Vollkommene Umnachtung also. Ich tickte aus. Ich schrie los, fummelte meine Lampe wieder an, ein wildes Geflacker, kraxelte mit rauschenden Ohren die Leiter rauf, ein metallisches Kitzeln am Gaumen. Immer wieder rief ich Leonies Namen und nach Malte rief ich auch. Es fällt mir schwer, mir das alles im Nachhinein einzugestehen. Den Kontrollverlust. Die lächerlichen Gedanken.
Als ich schnaufend oben ankam, blieb mir für Sekunden die Luft weg. Ich würgte. Kotzte ein wenig, drängte es aber zurück. Wieder versuchte ich zu rufen. Es kam nichts raus.
Der Gang verzweigte sich. Ich schleppte mich weiter, erkannte nichts wieder. Sterben würde ich. Und dann? Ich stellte mir Leonie vor. Bei der Bergung meiner Leiche würde sie sich auf mich werfen, bittere, wunderschöne Tränen vergießen. Und Malte würde mit den Füßen scharren – eigentlich war ich ihm doch immer wie ein großer Bruder gewesen. Ja, so würde es sein, dachte ich. Sie würden meinen Abschiedsgruß finden, Sartre lag falsch! würde ich mir mit einem scharfen Stein in die sterbende Brust geritzt haben, geläutert im Angesicht des Todes …
Bald sackte ich zusammen. Mit der Hand strich ich über den feuchten Fels, schmierte mir den Dreck über die Wangen. Ich musste jetzt ein minero sein, sagte ich mir. Ich musste die Mine spüren. Ihre Macht brechen … Irgendwann würde ich auf einen Tío stoßen. Alles würde ich ihm geben. Auch mein Geld. Aber nicht die Kreditkarte, was sollte er auch damit – bei der Banco de Crédito am Automaten stehen, sich während des Wartens die Unterhose aus der Ritze zupfen?
Ich lachte wütend auf bei der Vorstellung – erschrak aber sofort vor dem abscheulichen Geräusch und erschrak auch, als ich mein eigenes Wimmern wahrnahm als etwas irgendwie Äußerliches, bevor ich überhaupt kapiert hatte, dass ich weinte.
Nein. Ich würde hier einfach einschlafen. Und dann würde eine Lore kommen. Lichter und Arbeiter sausen
vorbei. Doch einer dreht um, lamentierend, was ich denn da mache und so weiter, kopfschüttelnd flucht er auf Quechua vor sich hin. Er setzt sich zu mir, raucht. Ich weiß nichts zu sagen, „lo siento, lo siento“ vielleicht. Bald kommt die nächste Lore.
Sie retten mich.
Dann liege ich draußen im Schatten der Lamabluthütte. Wasser, Atemluft, ich erhole mich. Meine Retter sind fort. Und später würde ich erzählen: ‚Was für mich ein Kampf ums Überleben war, ist für diese wackren Jungs der nackte, harte Alltag.‘ Und die Zuhörer würden nicken und verstehen, dachte ich und streichelte den Fels unter mir. Irgendwann musste ich pinkeln.
Ich stemmte mich hoch, schmierte mir den Rotz aus dem Gesicht und schlurfte ein paar Schritte um eine Biegung. Dann, als ich meine Minenarbeiterhose wieder zugeschnürt hatte, entdeckte ich den Pfeil an der Wand.
Weitere Pfeile folgten.
Es war so lächerlich.
Nach wenigen Minuten hörte ich schon Bolívars Stimme, sah den Schein der Lampen, dann das Sonnenlicht.
„Alles klar?“, fragte Leonie, als ich mich draußen neben sie
stellte.
Ich versuchte zu lächeln.
„Nur mal austreten“, antwortete ich.
Sie lächelte auch.
„Hast dich ja ganz schön eingesaut da drinnen“, sagte sie und schmierte mir mit dem Zeigefinger über die Wange. Ich zuckte mit den Achseln, schaute schnell weg. Wir beobachteten, wie Bolívar einige hundert Meter die Abraumhalde hinunterkletterte, dort das Dynamit ablegte und gemächlich wieder zu uns hinaufkam. Malte gesellte sich zu uns, haute mir auf die Schulter.
„Naa? Wie gut, dass wir dich mitgenommen haben, oder?“
„Klar. Großartig. Hatte eben ein bisschen Schiss.“
„Ach was“, sagte Leonie, „wir doch auch.“
Wenige Sekunden später explodierte die Ladung, wir schrien kurz auf. Dann klatschten wir.
Am nächsten Morgen, der Cerro Rico lag im Nebel, setzte ichmich ohne Abschied von den andern in den Bus nach La Paz.

Vorherige Teile unserer Reihe (die Diskussion mit den SMW-Redakteur*innen und das Gedicht von Carla Hegerl) findet man hier.
Valentin MORITZ wurde 1987 im ländlichen Südwestdeutschland geboren. Er studierte Germanistik, Hispanistik sowie Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft in Berlin und Sevilla. Er veröffentlichte seine Prosatexte bislang in Literaturzeitschriften, Anthologien und Magazinen und wurde mit renommierten Preisen und Stipendien ausgezeichnet. 2015 erschien der kurze Erzählband Grottenhermann. Valentin Moritz lebt in Berlin, versucht der Stadt aber ständig zu entkommen. Seine Lesungen in Deutschland und anderen europäischen Ländern gestaltet er multimedial und in Kooperation mit anderen Autor*innen und Künstler*innen – eine Übersicht dazu auf: valentin-moritz.de.
GERE Viktória wurde 1994 in Budapest geboren. Sie studierte Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin. Zurzeit ist sie Masterstudentin der Kunstgeschichte.